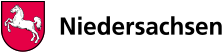Bildrechte: HR Nord
Bildrechte: HR NordStellungnahmen der HR Nord zum Vorhaben des Nds. Justizministeriums zur Restrukturierung der Rechtspflegerausbildung in Niedersachsen durch Auflösung der Hochschule und Neugründung einer Justizakademie
Die Norddeutsche Hochschule spricht sich gegen die Umwandlung in eine Akademie aus.
|
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sind als sachlich unabhängige, nur Recht und Gesetz unterworfene Organe unverzichtbare Stützen unseres Rechtsstaats (vgl. § 9 RPflG). Das findet Anerkennung in ihrem Hochschulabschluss, der vom Bundesgesetzgeber bewusst gewählt wurde, um Berufsfertigkeit und Bundeseinheitlichkeit der Ausbildung zu gewährleisten (vgl. § 2 RPflG). Der Verlust des Hochschulstatus in Niedersachsen gefährdet die Bundeseinheitlichkeit des Abschlusses und die hohe fachliche Qualifikation, die der Beruf des Rechtspflegers voraussetzt. Eine Akademie kann eine weisungs-unabhängige Ausbildung nicht in vergleichbarem Maß aufrechterhalten und auch keinen Hochschulgrad verleihen. |
Stellungnahme zum Eckpunktepapier des Niedersächsischen Ministeriums für Justiz (MJ) zur geplanten Gründung einer Norddeutschen Justizakademie in Hildesheim
A. Zur Ausgangslage[1]
Die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege (HR Nord) ist eine selbstständige Körperschaft des öffentlichen Rechts nach dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG). Die bewusste Gestaltung als „Hochschule“ in diesem Sinne beruht auf bundesrechtlichen und verfassungsrechtlichen Grundsatzentscheidungen: Laut den Gesetzesmotiven zu § 2 Abs. 1 S .2 RPflG des Bundes muss die Rechtspflegerausbildung an Hochschulen oder (rechtlich) vergleichbaren Einrichtungen erfolgen, weil Rechtspfleger (§ 9 RPflG) wie auch Richter (Art. 97 Abs. 1 GG) weisungsunabhängig arbeiten, nur an Gesetz und Recht gebunden sind und dazu die wesentlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden bereits bei Berufseinstieg anwenden können müssen.[2] Dies zeigt sich besonders deutlich – und wird vom Bundesgesetzgeber schon 1976 zutreffend herausgestellt – an den zunehmenden Aufgabenübertragungen vom Richter auf den Rechtspfleger.[3] Verfassungsrechtlich unterstehen Hochschulen nicht umsonst dem Schutz des Art. 5 Abs. 3 GG. Denn höhere Bildung soll unabhängig von politischen Steuerungs-versuchen erfolgen können.[4] Das muss erst recht für die Ausbildung weisungsunabhängiger Justizorgane gelten.[5]
Es gab also gewichtige Gründe, warum 2007 für das Justizressort die HR Nord als Hochschule eingerichtet wurde und nicht etwa wie bei den Fachbereichen Allgemeine Verwaltung, Polizei und Steuer die Überführung in eine Akademie erfolgte.[6] Die Planungen des Justizministeriums stellen insofern einen Rückschritt dar und vermögen nicht zu überzeugen.
B. Zur aktuellen Situation an der HR Nord und den Vorschlägen des Ministeriums
Wie das Ministerium für Justiz selbst anerkennt, bilden die Lehrkräfte an der Hochschule hochmotiviert, engagiert und mit gutem Erfolg aus (vgl. Eckpunktepapier [EPP] S. 1, B.). Soweit die Ausbildung in den letzten Jahren unter Druck geraten ist, hat dies jedoch andere Ursachen als die vom Ministerium angenommene Belastung durch die Selbstverwaltung bzw. die Strukturvorgaben des NHG (EPP, S. 1, B. 1. und 2.); problematisch erscheint vielmehr – auch mit Blick auf den vom Justizministerium angeführten demografischen Wandel – die sachliche und personelle Ausstattung der HR Nord vor dem Hintergrund der Zuständigkeit des Finanzministeriums, die so zu verbessern wäre, dass die Ausbildung mit den gewachsenen Anforderungen Schritt halten kann (EPP, S.1, B. 3.). Diese Problematik dürfte unabhängig von der Rechtsform (fort-)bestehen.
1. Zur Selbstverwaltung nach dem NHG
Soweit das Ministerium unter Punkt B.1. darauf verweist, dass sich die Regelungen des § 53 NHG zur Selbstverwaltung „in der Praxis als zu starr und unflexibel für den Lehrbetrieb“ erwiesen hätten, handelt es sich um ein nicht nachvollziehbares Argument. Insbesondere leidet der Lehrbetrieb nicht darunter.
Als Hochschule unter dem NHG verwaltet sich die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege selbst. Die Selbst-verwaltung ist Ausdruck von und dient dem Grundrecht auf Freiheit der Wissenschaft, Lehre und Forschung. Die HR Nord nimmt die Selbstverwaltung durch eine vereinfachte Struktur nach dem NHG wahr. Die Leitungsfunktionen des Rektors/der Rektorin, des Prorektors/der Prorektorin und des Studiendekans/der Studiendekanin werden sämtlich im Nebenamt ausgeübt. Der Senat, dem gemäß der Grundordnung nach § 53 Abs. 5 S. 1 NHG 13 Mitglieder mit Stimmrecht angehören, tagt nach seiner Geschäftsordnung grundsätzlich (und ohne besondere Vorkommnisse durchschnittlich) nur einmal pro Quartal. Diese singulären Termine binden weder maßgeblich Arbeitsressourcen noch werden sie auf das Lehrdeputat angerechnet. Ein Bezug zum Lehrbetrieb besteht insofern nicht. Unterstützt von einer schlanken Verwaltungsstruktur ist die HR Nord damit in der Lage, ihr Selbstverwaltungsrecht effizient wahrzunehmen. Hochschulrechts- und grundgesetzkonform liegt die zentrale Steuerung in den Händen der Mitglieder der Hochschule, die diese Aufgaben verantwortungsvoll und engagiert ausüben. Dies stellt weder eine besondere Belastung der Betroffenen dar noch bindet es nennenswerte Ressourcen. Im Gegenteil stellt die Selbstverwaltung sicher, dass Ziele und Tätigkeiten der Hochschule stets auf die Qualität der Lehre ausgerichtet bleiben und externen Einflussnahmen nicht unterworfen sind.
a) Zu den Lösungsvorschlägen des Ministeriums durch Rechtsformwechsel mit Blick auf die Verwaltungsbelastung durch Leitung und Lehre (EPP, C. 1 a).
Um das (vermeintliche) Problem zu lösen, schlägt das Ministerium eine mit dem Rechtsformwechsel verbundene Entkoppelung von Leitung und Lehre vor: Die Leitung der zukünftigen Akademie soll ganz von einer Lehrverpflichtung entbunden werden. Daher solle bei der Auswahl der Verwaltungsleitung „weniger die wissenschaftliche Qualifikation, sondern die Fähigkeit zur effektiven Bearbeitung von Verwaltungsangelegenheiten und Führungskompetenz im Vordergrund stehen“ (EPP, S. 3, C. 1. a.).
Diese Argumentation kann nicht überzeugen: Zum einen eröffnet dieser Ansatz didaktisch unerfahreneren Personen den Zugang zur Leitung einer Ausbildungseinrichtung. Dies birgt das Risiko, dass Lehrkräfte in Erklärungsnot für Sachzwänge des Unterrichtens und der Prüfungsvorbereitung geraten und so erhebliche Reibungsverluste entstehen. Für den Lehrbetrieb an der Akademie soll nach dem ausdrücklichen Vorschlag des Ministeriums die „stellvertretende Leitung“ zuständig sein, um die „Bedürfnisse der Lehrenden und der Studierenden unmittelbar an die Leitung herantragen zu können“ (EPP S. 3, C. 1.a.). Das bestätigt, dass die Akademieleitung nach der Planung des Ministeriums selbst keinen unmittelbaren Zugang zur Lehre mehr haben wird. Der Vorschlag eröffnet zudem das Risiko, dass die stellvertretende Leitung in Konflikten zwischen Leitungsvorgaben und Lehrbedarf aufgerieben wird.
Im Übrigen erscheint es vor dem Hintergrund der bundesrechtlichen Vorgaben zur hochschulrechtlichen Ausgestaltung fragwürdig, die Akademieleitung soweit von der Lehre zu entkoppeln: Der Ansatz des Ministeriums steht im Widerspruch zu § 2 Abs. 1 S. 2 RPflG, der gerade wegen der zu vermittelnden wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden eine Ausbildung auf Ebene der Fachhochschulen verlangt. Die angestrebte „Entkoppelung“ von Leitung und Lehrerfahrung gefährdet die Einhaltung der bundesrechtlichen Vorgaben zur Rechtspflegerausbildung. Wenn die Leitung überwiegend nach exekutiven Vorerfahrungen ausgewählt werden soll, wird sie auf die Gewährleistung der wissenschaftlichen Lehre nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 RPflG möglicherweise nicht ausreichend hinwirken können.
b) Zu den Gefahren des Verlustes des verfassungsrechtlichen Schutzes der Hochschulen bei der Ausbildung weisungsunabhängiger Justizorgane
Die Aufhebung der hochschulrechtlichen Selbstverwaltungsstruktur für die Ausbildung von Justizorganen und die damit verbundene direkte Einflussnahme der Politik auf die Juristenausbildung erscheint verfassungsrechtlich bedenklich.[7] Daher erscheint es richtig und angemessen, wenn hochrangige Ministeriumsvertreter die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts in dieser Situation stärken möchten.[8] Für die Unabhängigkeit der Hochschulen sollte – mit Blick auf Art. 5 Abs. 3 GG – nichts Anderes gelten, gerade in so sensiblen Bereichen wie bei der Ausbildung weisungsunabhängiger Justizorgane.
c) Zum Erhalt der Beteiligung von Dozierenden und Studierenden an der Weiterentwicklung der Lehre durch einen Akademierat (EPP, C. 1 d.)
Das Ministerium glaubt, die Beteiligung der Dozierenden und Studierenden bei Fragen der fachtheoretischen Ausbildungsgestaltung durch einen Akademierat aufrechterhalten zu können (EPP S. 5, C. 1 d). Sofern eine solche Mitbeteiligung an Lehrplanung und Prüfungsgestaltung ein Äquivalent zum Senat als Beteiligungsorgan (bisher § 53 Abs. 2 NHG) darstellen soll, erschließt sich der Gewinn durch den Rechtsformwechsel nicht: Verglichen mit der Wahrnehmung der Interessenvertretung im Senat würde sich die Belastung der beteiligten Dozierenden und Studierenden kaum ändern; Akademierat und Vertreter wären lediglich dem Anwendungsbereich des NHG und dem Schutz des Art. 5 Abs. 3 GG entzogen.
Der Gewinn durch die angestrengte Neuregelung erschließt sich nur bei einer veränderten Besetzung oder Verkleinerung des Organs. Dieses Ziel wird vom Ministerium auch angedeutet: Die ausbildenden Länder, die Oberlandesgerichte sowie das Ministerium sollen unmittelbar im Akademierat vertreten sein (EPP S. 5, C.1.d.). Soweit der Akademierat so besetzt sein sollte, dass die Mitspracherechte der Dozierenden und Studierenden im Verhältnis zu anderen Gruppierungen (Verwaltung, Ausbildungsbehörden) eingeschränkt werden, steht einem vergleichbaren Arbeitsaufwand dann ein geringerer Nutzen für die von der Lehre direkt betroffenen Personen gegenüber: In entscheidenden didaktischen Fragen und Prüfungsangelegenheiten würden sie Mitsprachemöglichkeiten im Wesentlichen einbüßen. Der Wegfall der Studienkommission bei Umwandlung in eine Akademie würde darüber hinaus die Mitsprache von Studierenden und Lehrenden gravierend beeinträchtigen. Die Einbindung der beteiligten Einstellungsbehörden findet zur Zeit u.a. durch eine jährlich stattfindende Evaluationsbesprechung statt, an der auch Studierendenvertreter und die Praxiskoordinierungsstelle der Hochschule beteiligt sind.
2. Zu den Stellenbesetzungsverfahren nach dem NHG
Unter B.2. des Eckpunktepapiers verweist das Ministerium auf die Langwierigkeit der Stellenbesetzungen im Geltungsbereich des NHG. Hier könnte das Ministerium das Verfahren maßgeblich beschleunigen, wenn Berufungsvorschläge für die Besetzung von W2-Stellen zügig durch das Ministerium bestätigt und Fachhochschuldozenten nach Feststellung ihrer fachlichen Eignung schnell ernannt würden. Gerade die Wartezeit zwischen Berufungsvorschlag und Rufmitteilung erhöht das Risiko, die besten Bewerberinnen an andere Einrichtungen zu verlieren. In einem aktuellen Verfahren ist über eine Ruferteilung binnen einen Jahres seit Entscheidung des Senates durch das Justizministerium nicht entschieden worden.
a) Zu den Lösungsvorschlägen des Ministeriums: kürzere Stellenbesetzungsverfahren durch Rechtsformwechsel (vgl. C.1 c.)?
Das Stellenbesetzungsverfahren ist nicht nur, wie vom Ministerium behauptet, durch § 26 NHG veranlasst, sondern dient in der jetzigen Form der unmittelbaren Qualitätssicherung der Lehre: Nur, wer seine pädagogische Eignung sachgerecht durch Lehrproben nachgewiesen hat (§ 1 Abs. 3 S. 2 PersVO-FHR), kann den Anforderungen der von
§ 2 Abs. 1 RPflG vorgeschriebenen Hochschullehre gerecht werden. Gerade, wenn der geplante Rechtsformwechsel der Qualitätssicherung der Lehre dienen soll, dürfen von diesen Auswahlkriterien keine Abstriche gemacht werden. Nicht ohne Grund schreibt zum Beispiel auch § 10 Abs. 4 S. 2 PolAkG Nds. die Einrichtung einer Auswahlkommission hinsichtlich der Professoren an der Polizeiakademie vor. Zur Qualitätssicherung der Lehre würden auch nach einem Rechtsformwechsel durch einen Akademierat entsprechende Maßnahmen zu treffen sein; der Rechtsformwechsel selbst könnte also nur dann eine zügigere Stellenbesetzung ermöglichen, wenn in erheblichem Umfang auf Maßnahmen der Qualitätssicherung wie auf Lehrproben und Bewährung verzichtet würde. Ein solcher Verzicht würde mit Blick auf den Wandel der Rechtspflegertätigkeit nicht nur einen Rückschritt bedeuten, sondern zugleich das Risiko erhöhen, dass zukünftig die Kriterien der Hochschulausbildung nach § 2 Abs. 1 S. 2 RPflG nicht erfüllt werden.
b) Zu den Lösungsvorschlägen des Ministeriums: Auflösung besoldungsrechtlicher Unterscheidungen (vgl. C.1b.)
Als Argument für den Rechtsformwechsel führt das Justizministerium an, dass die besoldungsrechtlichen Unterscheidungen zwischen FH-Dozenten und Professoren an einer Akademie aufgehoben werden würden, also Dozenten an der Justizakademie der Zugang zu den Beförderungsämtern (A 13 bis A 16) ermöglicht werden soll – allerdings (nur) bei „Übernahme von koordinierenden Aufgaben“ (S. 4, C. 1. b.).
Soweit im Eckpunktepapier des Justizministeriums zuvor ausgeführt wurde, dass Leitungsaufgaben zukünftig von der Lehre „entkoppelt“ werden sollen, besteht hier ein Widerspruch (vgl. oben Punkt 1a und im Eckpunktepapier S. 3, 1a). Denn die Übernahme der Leitung soll nach Vorstellung des Ministeriums gerade von der Lehre getrennt und vielmehr Verwaltungserfahrung ein entscheidendes Kriterium für die Übernahme von Leitungsfunktion sein. Verbunden mit dem Rechtsformwechsel sollen außerdem „die Lehrkräfte von anfallenden Verwaltungsaufgaben entlastet“ werden und sich „so auf ihre Kerntätigkeit, die Lehre“ konzentrieren können. Es bleibt daher offen, nach welchen Kriterien welche Lehrkräfte überhaupt bei Übernahme welcher Aufgaben von der höheren Besoldung profitieren könnten. Deutlich wird allerdings, dass der Zugang zur höheren Besoldungsgruppen gerade nicht allen FH-Dozentinnen, sondern nur einigen wenigen offenstehen wird. Insofern scheint auch fragwürdig, ob auf diesem Weg tatsächlich der gesteigerte Einsatz von Rechtspflegern an der Justizakademie erreicht werden kann. Denn die Übernahme der unbenannten koordinierenden Aufgaben wird nicht direkt jedem möglich sein, sondern Kenntnis des Lehr- und Prüfungsbetriebs und Lehrerfahrung voraussetzen.
Sofern gleiche Besoldung für gleiche Arbeit angestrebt wird, ist nicht ersichtlich, warum ein solcher Vorstoß nicht auch im Rahmen der bestehenden hochschulrechtlichen Struktur möglich sein sollte. Grundsätzlich obliegt die sachliche und personelle Ausstattung der Hochschule allerdings der Finanzierungsbewilligung des Finanzministeriums. Diese Abhängigkeit ist nicht durch die Rechtsform beeinflusst und es erscheint zweifelhaft, ob und wie weit durch einen bloßen Rechtsformwechsel dauerhaft nennenswert höhere Mittel für eine durchgängige Besserbesoldung aller Dozierenden der A-Besoldung zur Verfügung stehen sollten.
c) Zu dem Einwand des Ministeriums, auf dem Hochschulmarkt nicht mit juristischen Fakultäten konkurrieren zu können (vgl. S.2, 2.)
Das Ministerium trägt vor, Professorenstellen wegen konkurrierender Berufungsverfahren an den juristischen Fakultäten nicht besetzen zu können und verweist dabei auf die dort gebotene W3-Besoldung. Tatsächlich besteht ein solcher Zusammenhang nicht bzw. lediglich in eingeschränkter Form: Die Berufung von W2 und W3-Professuren unterliegt in Niedersachen § 25 NHG und verlangt einen über die Promotion hinausgehenden weiteren didaktischen und wissenschaftlichen Nachweis (dort Abs. 1 Nr. 4), regelmäßig in Form einer im Rahmen einer Habilitation oder Juniorprofessur erbrachten Leistung. Dieses Kriterium erfüllen beispielsweise die meisten Kollegen aus dem Richter- und Rechtspflegerdienst nicht. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber zugleich, dass gerade für diese Berufsgruppen die Übernahme einer Professur an der HR Nord als Statusamt in der bestehenden Rechtsform (!) durchaus attraktiv ist, da praktische Erfahrung für die Stellenbesetzung an Fachhochschulen gefordert ist (§ 25 Abs. 2 Satz 2 i.V.m.
Abs. 1 Nr. 4c NHG).
Zudem ist die HR Nord in der bestehenden Rechtsform aufgrund der prekären Ausschreibungssituation an den juristischen Fakultäten auch für Privatdozenten attraktiv: Das Wissenschaftszeitgesetz führt zu einer Befristung der Arbeitsverhältnisse an Universitäten und wertet jede unbefristete Stelle auf, insbesondere bei Menschen mit Familienverantwortung. Jeder Privatdozent, der sich mit Lehrstuhlvertretungen wirtschaftlich über Wasser hält, wird die Übernahme einer unbefristeten W2-Professur der bloßen Aussicht auf eine W3-Professur vorziehen. Dieser Personenkreis sollte künftig besonders angesprochen werden. In der bestehenden Rechtsform könnte außerdem erwogen werden, von der hochschulrechtlichen Möglichkeit der Verwaltung einer Professur nach § 26 Abs. 7 NHG Gebrauch zu machen und so Vakanzen schnell schadlos für den Lehrbetrieb zu gestalten.
3. Zu den Herausforderungen des demografischen Wandels (EPP B.3.) und warum die Pläne des Ministeriums keine Abhilfe versprechen
Zutreffend ist, dass aufgrund des Praxisbedarfs die Studierendenzahlen steigen sollen und eine höhere Bewerber-quote und Bestehensquote in den Prüfungen wünschenswert ist (vgl. nicht nur EPP S.2, B.3. und das Instagram-Video der Justizministerin). Der Aussage, dass „eine hohe Qualität der Ausbildung“ hierzu erforderlich ist (EPP S.3 oben), ist zuzustimmen. Die in dem Eckpunktepapier angeführten Maßnahmen sind aber nicht zielführend. Studium und Beruf müssen für Studieninteressierte eine große Attraktivität bieten. Einer Ausbildung an einer Akademie fehlt diese Attraktivität, so dass die Bewerberzahlen voraussichtlich weiter zurückgehen werden.
Die in Aussicht gestellte schnelle Besetzung von Stellen durch Lehrpersonal (in Abordnung) dann wohl ohne hin-reichende Qualitätssicherungsmaßnahmen in Form von Lehrproben und Bewährungszeiten gefährdet den Ausbildungsstandard ebenso wie der völlige Verzicht auf wissenschaftlich ausgebildetes Lehrpersonal. Es erscheint zweifelhaft, ob nach einem Rechtsformwechsel in vergleichbarem Maß noch erfahrene Richter, Rechtspfleger oder Privatdozenten für einen Einsatz an einer „Akademie“ zur Verfügung stünden. Da eine Akademie hochschulrechtlich nicht als gleichwertig gilt,[9] wäre sie auch auf dem Stellenmarkt weniger konkurrenzfähig als eine Hochschule. Die Ausbildungsqualität würde mittelfristig durch die angestrebten Maßnahmen nicht zu-, sondern abnehmen. Vor allem aber wäre mit Blick auf die Vermittlung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden der Ausbildungsstandard des § 2 Abs. 1 S.2 RPflG gefährdet, wenn wissenschaftlich ausgebildetes Lehrpersonal dem Kollegium der „Akademie“ verloren ginge. Gemäß § 27 Abs. 3 NHG können Professorinnen und Professoren ohne ihre Zustimmung nur an eine andere Hochschule abgeordnet oder versetzt werden (nicht also an eine Akademie), wenn die Hochschule, an der die betreffende Person tätig ist, aufgelöst oder mit einer anderen Hochschule zusammengeschlossen wird.[10]
Es bleibt auch zweifelhaft, ob allein der Rechtsformwechsel die Gewinnung neuer Kollegen aus der Praxis dauerhaft erleichtern würde. Denn verglichen mit den Arbeitszeiten am Gericht ist der Einsatz bei einem vollen Deputat in den ersten Jahren bei einer Lehrverpflichtung von 666 Stunden deutlich höher, insbesondere, wenn Fächer das erste Mal unterrichtet werden. Hinzukommen erhebliche Korrekturlasten. Gerade die Qualität der Lehre verbessert sich aber in der Regel mit längerer Erfahrung, so dass die vorübergehende Beschäftigung von Lehrenden im Abordnungsverhältnis einen Qualitätsverlust riskiert.
C. Fazit: Keine Nachteile für die Studierenden durch den Rechtsformwandel? (EPP c.2.)
Diese abschließende Behauptung des Ministeriums, den Studierenden entstünden keine Nachteile durch den Rechtsformwechsel, ist ebenfalls nicht überzeugend: Eine Vielzahl der Maßnahmen (Entkoppelung der Leitung von der Lehre, Abschaffung des Senats, schnellere Stellenbesetzungen durch teilweise weniger erfahrenes Lehrpersonal) gefährden den hohen Anspruch, den § 2 Abs. 1 S. 2 RPflG an die Ausbildung der Rechtspfleger an einer Hochschule stellt. Kommt dann noch hinzu, dass die übrigen Rechtspflegerhochschulen bundesweit ihren hochschulrechtlichen Status behalten, wird deutlich, dass Niedersachsen aus der Bundeseinheitlichkeit der Ausbildung von Rechtspflegern ausschert.[11] Die Studierenden sorgen sich daher zurecht, ob an einer Akademie erworbene Abschlüsse „Diplom-Rechtspfleger (Akademie)“ bundesweit Anerkennung finden würden. Diese Zweifel wird das niedersächsische Justizministerium auch nicht durch eine gesetzliche Fiktion beheben können.[12] Bei Einhaltung des hochschul-rechtlichen Ausbildungsstandards gäbe es aber endgültig keinen sachlichen Vorteil durch einen Rechtsformwechsel mehr, denn es würde sich allenfalls die Bezeichnung ändern. Bedenklich ist auch die späte Beteiligung der übrigen der HR Nord verbundenen Länder Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein, die erst nach Verkündung der Pläne in Niedersachsen erfolgt ist (vgl. Pressemitteilung des Ministeriums vom 17.02.2025). Fraglich ist, ob diese Bundesländer einer nds. Akademie verbunden blieben. Dies wäre für das Land Niedersachsen und die Stadt Hildesheim eine negative Entwicklung.
Der behauptete „Qualitätsboost“ für die Ausbildung erscheint als reines Marketing: Wie oben dargelegt, wird die Lehre durch die angekündigten Maßnahmen an Qualität mittelfristig verlieren. Dass zudem der Einfluss der Lehrenden und Studierenden auf Unterrichts- und Prüfungsinhalte durch die Einrichtung eines Akademierates zurückgehen würde, kann ebenfalls nicht im Interesse der Studierenden sein. Vor allem aber gibt es keinen einzigen Verbesserungsvorschlag des Ministeriums, der sich bei gleichzeitigem Erhalt der Qualität der Lehre nicht nur ebenso gut, sondern besser auch an einer Hochschule umsetzen lassen würde, wenn sowohl das Justiz- wie auch das Finanzministerium zu einer zielführenden Reform bereit wären.
Für die Mitarbeit in den von der Ministerin angekündigten Arbeitsgruppen steht die Hochschule sehr gerne zur Verfügung.
Hildesheim, den 4. April 2025
In Vertretung
Prof. Annegret Hannemann
Prorektorin[1] Der Text verwendet für eine bessere Lesbarkeit männliche und weibliche Schreibweise gleichwertig als Äquivalent zum generischen Maskulinum. Gemeint sind jeweils alle Geschlechter.
[2] BT-Drucksache 7/2205 S. 5.
[3] BT-Drucksache 7/2205 S. 5
[4] Statt vieler zunächst nur Krüper, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, Art. 5 III GG, Rn. 22, 25.
[5] Statt vieler vgl. zunächst nur Funke, Haltung zeigen oder Haltung einnehmen? – Justizunrecht des 20. Jahrhunderts in der Juristenausbildung, in: NJW 2018, 1930 -1933.
[6] LT-Drucksache 15/3595 S. 17; Hochschulausbildung ist gem. § 2 RPflG erforderlich (BeckOK Hochschulrecht Nds, Hudy NHG § 53 Rn. 2).
[7] „Namentlich ergänzt die Gewährleistung des Selbstverwaltungsrechts aus Art. 5 III NV die aus Art. 5 III S.1 GG abgeleiteten Anforderungen an die Organisation der Hochschulen“. Epping, Niedersächsisches Hochschulgesetz, Einleitung, Rn. 1.
[8] https://www.ndr.de/nachrichten/info/Smollich-Bundesverfassungsgericht-muss-besser-geschuetzt-werden,audio1562064.html (abgerufen am 09.03.2025)
[9] Epping, in: Epping, NHG, 2. Aufl. 2023, Einl. Rn. 29; VG Göttingen BeckRS 2013, 59006.
[10] Neuhäuser, in: Epping, NHG a.a.O. § 27 Rn. 37.
[11] Siehe hierzu bereits die Erste Stellungnahme der Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege, https://hr-nord.niedersachsen.de/startseite/hochschule/erste-stellungnahme-der-hr-nord-zum-vorhaben-des-nds-justizministeriums-zur-restrukturierung-der-rechtspflegerausbildung-in-niedersachsen-durch-auflosung-der-hochschule-und-neugrundung-einer-justizakademie-239742.html (abgerufen am 31.03.2025)
[12] Erste Stellungnahme der Hochschule (siehe FN 11).
Erste Stellungnahme der Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege
Die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege lehnt den Vorschlag der niedersächsischen Landesregierung ab, die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege (HRNord) in Hildesheim zum 01.01.2026 aufzulösen und stattdessen eine Justizakademie als nachgeordnete und weisungsgebundene Justizbehörde zu gründen.
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sind nach § 9 Rechtspflegergesetz (RPflG) ein sachlich unabhängiges Entscheidungsorgan der Justiz. Sie üben ihre Tätigkeit weisungsfrei und eigenverantwortlich aus, was eine hochwertige und unabhängige Ausbildung erfordert. Den rechtlichen Rahmen schafft der durch das zweite Gesetz zur Änderung des Rechtspflegergesetzes vom 18.08.1976 (BGBl. I S. 2186) eingefügte § 2 Abs. 1 S. 2 RPflG. Mit dieser Norm hat der Bundesgesetzgeber ein Studium auf Bildungsebene der Fachhochschule oder einem vergleichbaren Studiengang vorgeschrieben: „Da der Aufgabenbereich der Rechtspfleger fast ausschließlich durch Bundesgesetze geregelt ist, muß auch ihre Ausbildung nach einheitlichen Grundsätzen erfolgen" – und zwar bundesweit (BT-Drs. 7/2205 S. 5). Der Zweck des § 2 Abs. 1 S. 2 RPflG besteht mithin darin, eine „Zersplitterung" der Ausbildung zu vermeiden (Dörndorfer, RPflG, 4. Aufl. 2023, § 2 Rn. 7). Hinzu kommt eine Änderung des Berufsbildes, die daher rührt, dass „der Kreis der vom Richter auf den Rechtspfleger voll übertragenen Rechtsgebiete erheblich ausgedehnt worden" ist (BT-Drs. 7/2205 S. 5).
Dieser (aktuell sogar noch beschleunigte) Wandel erfordert eine Ausbildung, „die den Rechtspfleger zur Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden befähigt" (BT-Drs. 7/2205 S. 5). Eine lediglich wortgetreue Auslegung des Gesetzes ist oft nicht ausreichend, Normen müssen interpretiert werden und nicht geregelte Sachverhalte mittels Analogie und Teleologie entschieden werden können (Arnold u.a., RPflG, 8. Aufl. 2015, § 2 Rn. 64 f.). Der Studiengang hat deshalb praktische und theoretische Elemente zu umfassen, „die als gleichgewichtig anzusehen sind" (BT-Drs. 7/2205 S. 5). Es gibt also gute Gründe, warum der Bundesgesetzgeber auf der Ebene von Fachhochschulen einen einheitlichen Standard hat festlegen wollen (s. den Überblick bei Arnold u.a., RPflG, 8. Aufl. 2015, § 2 Rn. 61-63). Mit der Einrichtung einer Justizakademie würde Niedersachsen aus der bundeseinheitlichen Regelung ausscheren und nicht nur einer gesetzwidrigen „Zersplitterung" der Ausbildung Vorschub leisten, sondern auch einen länderübergreifenden Stellenwechsel gefährden. Darüber hinaus käme es zu einer mit § 2 Abs. 1 S. 2 RPflG unvereinbaren Abwertung der fachtheoretischen Ausbildung.
Ausbildung und Abschluss an einer Akademie sind nicht mit einem Fachhochschulstudium gleichzusetzen. Für die niedersächsische Polizeiakademie hat das Verwaltungsgericht Göttingen (Urt. v. 6.11.2013 - 1 A 190/13, BeckRS 2013, 59006, beck-online) festgestellt, dass die Ausbildung an der Polizeiakademie nicht als Hochschulstudium anzusehen ist. Das bundesrechtliche Gebot der Ausbildung auf Fachhochschulebene kann das Land nicht durch eine gesetzliche Fiktion aushebeln. Gem. § 8 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) dürfen zudem Hochschulgrade wie der von der HRNord bislang verliehene Diplomgrad (vgl. § 53 Abs. 1 S. 3 NHG) ausschließlich von Hochschulen verliehen werden. Bei dem vom MJ avisierten Ausbildungsabschluss kann es sich folglich nicht um einen Hochschulgrad handeln (vgl. HK-NHG/Becker, 2. Aufl. 2023, NHG § 8 Rn. 53). Auch diese qualitative Herabstufung ließe sich nicht durch eine gesetzliche Gleichwertigkeitsbestimmung kompensieren. Die Gründung der Steuerakademie im Jahr 2006 kann daher nicht als Blaupause für die Auflösung der HR Nord dienen. § 48 Abs. 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten (StBAPO) stellt geringere Anforderungen als § 2 Abs. 1 S. 2 RPflG. § 2 Abs. 1 S. 2 RPflG ist der Grund, warum die Rechtspflegerausbildung bei der Auflösung der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege im Jahr 2007 als einzige Fakultät nicht in eine Berufsakademie überführt wurde (vgl. LT-Drs. 15/3595 S. 17).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Ausbildung und Abschluss an einer Justizakademie dem bisherigen qualitativen Standard nicht entsprechen werden. Im Vergleich zur bundesrechtlichen Reformgesetzgebung bildet der Vorschlag der niedersächsischen Landesregierung einen Rückschritt. Mit Blick auf die gewandelten Aufgaben der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger muss die mit der Einrichtung einer Justizakademie einhergehende qualitative Herabstufung der Ausbildung geradezu als anachronistisch bezeichnet werden. Die in einer Akademie ausgebildeten Absolventinnen und Absolventen wären im bundesweiten Rahmen Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger zweiter Klasse. Fraglich wäre, ob sie überhaupt noch Rechtspfleger im Sinne des RPflG wären, weil sie keinen den Anforderungen des § 2 Abs. 1 S. 2 RPflG entsprechenden Vorbereitungsdienst abgeleistet hätten. Die Folgen wären nicht absehbar - wer kann ausschließen, dass künftig Entscheidungen nicht allein deshalb aufgehoben werden, weil sie nicht von einem Rechtspfleger im Sinne des § 2 Abs. 1 S. 2 RPflG getroffen worden sind?
 Bildrechte: HR Nord
Bildrechte: HR NordStellungnahme Rektorenkonferenz der Hochschulen für den öffentlichen Dienst.pdf